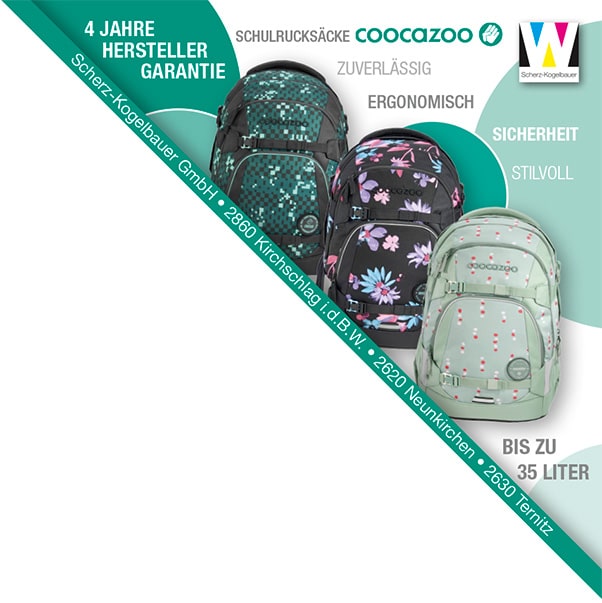2023 wurde der Gedenkstein in Scheiblingkirchen-Thernberg errichtet (v.li.): der damalige Bgm. Johann Lindner, Historikerin Maria Stangl, GfGR Lukas Heilingsetzer, GfGR Karl Danhel, GR Renate Stadler, Vizebgm. (heute Bgm.) Waltraud Ungersböck; / Foto: Ungersböck, Lechner
In der Region wurde in den vergangenen Jahren viel historische Bewusstseinsarbeit geleistet – wie beispielsweise in Scheiblingkirchen-Thernberg. Im Gespräch mit Historikerin Waltraud Lechner blickt der „Bote“ auf die Geschichte, die bis in die Gegenwart hineinwirkt.
In Scheiblingkirchen-Thernberg erinnert seit Herbst 2023 ein Gedenkstein in der Pfarrgasse an die jüdischen Familien, die bis zu ihrer Vertreibung während des Nationalsozialismus hier gelebt haben. Die Zeit des Zweiten Weltkrieges und die Jahre danach veränderten die Besitzverhältnisse in der Gemeinde. Viele mussten ihr Hab und Gut verkaufen, um ihre Flucht finanzieren zu können, andere, deren Besitztümer nicht beschlagnahmt oder ihnen zurückgegeben wurden, verkauften diese nach dem Krieg.
Geschichte, die alle betrifft
Dass dieses Wissen in der Gemeinde und in der Region bewahrt geblieben ist, ist zu einem großen Teil auf das Regionsprojekt zur jüdischen Geschichte zurückzuführen. Die ortsansässigen Historikerinnen Maria Stangl und ihre Schwester Waltraud Lechner gehörten zu jenen, die intensiv die Geschichten der jüdischen Familien erforschten – so wie jene der Kaufmannsfamilie Löbl. 1879 erwarb Julius Löbl die Liegenschaft in Scheiblingkirchen, in der später Leopold und Hermine Löbl ein Geschäft führten. Zeitzeugen beschrieben sie als liebenswürdig und nett, aber im März 1938 wurden sie vertrieben. 1941 übernahm der Parteifunktionär Franz Mayer das Geschäft. In Gleißenfeld betrieb die Familie Löbl einen weiteren Kaufmannsladen, geführt von Ferdinand und Helene Löbl. Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus und zunehmenden Antisemitismus änderte sich die Situation dramatisch: Am 9. April 1939 nahm sich Ferdinand Löbl das Leben, seine Frau Helene und die beiden Kinder wurden schlussendlich 1942 in das Lager Wlodawa deportiert und getötet.
Die Geschichte der Familie Laub verläuft wenig besser: 1921 erwarb Adolfo Laub mehrere Häuser im Ort. Als seine Frau Emma aber 1935 Heidelbeeren mit Tollkirschen verwechselte und starb, entschloss sich Adolfo, nach Argentinien auszuwandern. Er nahm die argentinische Staatsbürgerschaft an, wodurch er nicht um seinen Besitz in Scheiblingkirchen gebracht werden konnte. Nach dem Krieg verkaufte er seine Liegenschaft an die Gemeinde, die darauf unter anderem ein Altenheim, ein Schwimmbad und einen Fußballplatz errichtete.
Errungenschaften weiterhin bewahren
„Nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Menschen emotional noch zu betroffen“, erklärt Lechner, „deshalb ist es gut, dass man die Geschichte nun sachlich aufarbeiten konnte. Die mittlerweile pensionierte Geschichtelehrerin war während des Projektes für die Geschichten in Warth und Seebenstein zuständig. Für sie ist eine der wichtigsten Lehren: „In der Schule lehren wir die Geschichte im Großen, doch dabei muss auch vermittelt werden, dass es sich dabei immer auch um die eigene Geschichte handelt.“ Ihre Schwester Maria etwa sei als Folge des Regionsprojektes nach wie vor in losem Kontakt mit den Nachkommen der Familie Laub. Für Lechner haben auch die Errungenschaften, die sich mit dem Staatsvertrag und später mit dem EU-Beitritt ergaben, eine wichtige historische und gegenwärtige Bedeutung. Sie plädiert dafür, sich der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen wieder stärker bewusst zu werden. Das Gedenk- und Jubiläumsjahr 2025 sei dafür eine Chance, so wie es auch das Regionsprojekt gewesen sei. „Um das Interesse für die Vergangenheit zu wecken, muss man auch die Gegenwart in den Blick nehmen.“

Waltraud Lechner